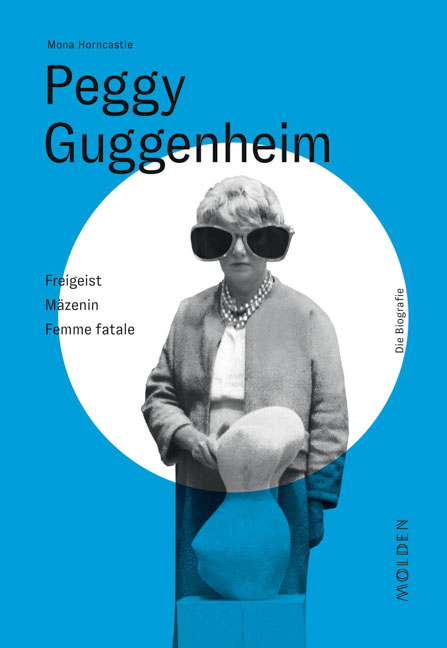Peggy Guggenheim galt schon zu Lebzeiten als exzentrische Berühmtheit und Femme fatale – ein Bild, zu dem sie mit ihrer provokant offen geschriebenen Autobiografie selbst beigetragen hat. Warum Biografin Mona Horncastle in „Peggy Guggenheim – Freigeist, Mäzenin, Femme fatale” auf Klatsch und Tratsch verzichtet hat und was wir heute von ihrer Protagonistin lernen können, verrät sie hier.
„Ich bin keine Kunstsammlerin. Ich bin ein Museum.“ Was verrät dieses Zitat über Ihre Protagonistin?
Peggy Guggenheim war schlagfertig und ironiebegabt – auch in Bezug auf sich selbst. Das steckt in diesem Zitat, mit dem sie sich gegen die zahlreichen Zuschreibungen wehrt, die oft negativ waren. Immer wieder musste sie sich anhören, zu ungebildet und ohne jedes Kunstverständnis zu sein, auch als sie schon eine der bedeutendsten Kunstsammlungen zusammengetragen hatte. Zu sagen: Bin ich nicht, ich bin viel bedeutender, ist eine so großartige Replik, dass es jedem Kritiker die Sprache verschlagen muss – oder besser: hätte müssen. Dem war leider nicht so, auch darum habe ich die Biografie geschrieben.
Sie zeichnen ein differenziertes Bild von Guggenheim – frei von Klatsch und Klischee. Welche Vorurteile wollten Sie mit diesem Buch bewusst brechen?
Der Blick auf Peggy Guggenheim war nicht nur zu ihren Lebzeiten chauvinistisch, sondern ist es bis heute, denn sie hatte viele Neider, bis über ihren Tod hinaus. Das hat mich gewundert und geärgert. Mag sein, dass das in der männlich dominierten Kunstwelt in der ersten Hälfte des 20. Jh. nichts Außergewöhnliches war, aber dass sie immer noch ständig degradiert wird (auch von Autorinnen!) darüber war ich nun doch einigermaßen erstaunt. Meine Leitfrage war: Wie würde man Peggy Guggenheim biografieren, wenn sie keine Frau, Mutter und Großmutter gewesen wäre, sondern ein Mann? Ein Sammler und Mäzen, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, mit seiner Kunstsammlung ein bleibendes Denkmal zu setzen? Welcher männliche Museumsgründer würde gefragt werden, warum er sein Lebenswerk nicht seinen Kindern vermacht hat? Warum er das ihm zugefallene Erbe sinnvoll und mit Augenmaß investiert hat? Wie viele Musen er auf dem Weg geküsst und wen er nicht beachtet hat? Und nicht zuletzt: Wer würde sich für sein Aussehen interessieren? Ob er ein guter Gastgeber war? Oder ein guter Vater? – Niemand. Das steht auch Peggy Guggenheim zu.
Guggenheim war Fluchthelferin, rettet mehr als 50 Kunstwerke vor den Nationalsozialisten. Warum wird dieser Teil ihres Lebens in der Öffentlichkeit oft übersehen?
Sie selbst hat kein großes Gewese darum gemacht, dass sie Marc Chagall, Marcel Duchamp, André Breton und Max Ernst die Flucht aus dem besetzten Frankreich ermöglicht hat. Das war nicht ihr Stil. Ebenso wenig, wie sie es jemals betont hat, dass ihre Sammlung überwiegend aus „entarteten“ Kunstwerken bestanden hat, die sonst wahrscheinlich im Museum Jeu de Paume gelandet wären, das den Nationalsozialisten als Zwischenlager für die enteigneten Kunstschätze gedient hat. In weniger als vier Jahren haben sie in Frankreich etwa 200 jüdische Kunstsammlungen enteignet und über 20.000 Objekte geraubt! Und was bei ihrem Abzug im August 1944 noch nicht verschachert hatten, das wurde verbrannt. Warum Peggy Guggenheim wann was gemacht hat, darüber schweigt sie sich meistens aus. Vielleicht hat Lee Krasner ihre Haltung am besten in Worte gefasst, als sie sagte: „She did it. Ganz gleich, was ihre Beweggründe waren.“
Was war das Überraschendste, was Sie in der Recherche über sie herausgefunden haben?
Über ihren Satz, „dass Leute wie die Guggenheims verpflichtet sind, die Welt zu verbessern“ – und dass sie das zu ihrem Lebensmotto gemacht hat. Sie, die Tochter aus der jüdischen New Yorker Oberschicht, hat die Arbeiterbewegungen in Amerika, Frankreich und England finanziell unterstützt! Darauf muss man erst mal kommen. Ohne Peggy Guggenheims finanzielle Zuwendungen hätte die feministische literarische Avantgarde um Djuna Barnes, Antonia White und Emily Coleman nicht sorglos schreiben können. Sie war außerdem die Erste, die surrealistische Künstlerinnen wie Leonora Carrington gefördert hat und (auch wenn sie auch darum nie ein Gewese gemacht hat) sie hat – wieder als Erste – Ausstellungen nur mit Künstlerinnen gemacht, das war ein absolutes Novum. Ohne den prozentualen Anteil von Künstlerinnen in anderen Museen und Galerien errechnet zu haben, glaube ich außerdem sagen zu können: Ein Frauenanteil von 40 % in ihrer Galerie in New York war konkurrenzlos.
Wofür steht Peggy Guggenheim heute – und was können wir aus ihrer Lebensgeschichte im Jahr 2025 lernen?
Da möchte ich gerne die sprachgewaltige Künstlerin Jenny Holzer zitieren. Eine Arbeit von ihr befindet sich im Garten von Peggy Guggenheims Palazzo in Venedig: SAVOR KINDNESS BECAUSE CRUELTY IS ALWAYS POSSIBLE LATER. Ein treffender Kommentar auf Peggy Guggenheims Leben und ihr Vermächtnis, wie ich finde.